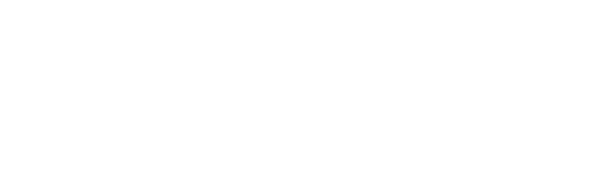Sarah Kane mal Zwei
 An einem dieser schönen Tage Anfang Juni treffe ich die zwei Regie-Teams des „Katharsis. Doublefeature“ von der Studiobühne Erlangen in der Yougurtbar. An einem Abend soll sowohl „4:48“ als auch „Gesäubert“ von Sarah Kane auf die Bühne gebracht werden. Während die einen – Maximilian Nix und Lydia Victor – an ihrem Teil des Abends bereits seit einem dreiviertel Jahr arbeiten, wollen die anderen beiden – Andreas Pommer und Matthias Bronnenmeyer – ihr „4:48“ in einer intensiven Probenphase von zwei Wochen in einem großen Experiment entstehen lassen. Während wir Eis löffeln, erzählen mir die 4 von ihrer Faszination für Sarah Kane und ihre Texte, von ihrer Idee eines eigenartigen Konzepts, von der Erfahrung, zu zweit Projektleiter für eine Inszenierung zu sein und von einem ganz bestimmten Modell der Theaterarbeit – ohne Hierarchie. Dabei haben sie eine Menge Spaß! Und es wird deutlich, dass der „Katharsis. Doublefeature“ — Abend ein spannender Abend voller Fragen werden wird. Fragen, die nicht nur Wahnsinnige betreffen.
An einem dieser schönen Tage Anfang Juni treffe ich die zwei Regie-Teams des „Katharsis. Doublefeature“ von der Studiobühne Erlangen in der Yougurtbar. An einem Abend soll sowohl „4:48“ als auch „Gesäubert“ von Sarah Kane auf die Bühne gebracht werden. Während die einen – Maximilian Nix und Lydia Victor – an ihrem Teil des Abends bereits seit einem dreiviertel Jahr arbeiten, wollen die anderen beiden – Andreas Pommer und Matthias Bronnenmeyer – ihr „4:48“ in einer intensiven Probenphase von zwei Wochen in einem großen Experiment entstehen lassen. Während wir Eis löffeln, erzählen mir die 4 von ihrer Faszination für Sarah Kane und ihre Texte, von ihrer Idee eines eigenartigen Konzepts, von der Erfahrung, zu zweit Projektleiter für eine Inszenierung zu sein und von einem ganz bestimmten Modell der Theaterarbeit – ohne Hierarchie. Dabei haben sie eine Menge Spaß! Und es wird deutlich, dass der „Katharsis. Doublefeature“ — Abend ein spannender Abend voller Fragen werden wird. Fragen, die nicht nur Wahnsinnige betreffen.
Reflex: Sarah Kane, was fasziniert euch an dieser Frau, was fasziniert euch an den Stücken, was interessiert euch an den Themen, die diese beiden Stücke behandeln?
Maximilian: Ganz Vieles. Ich persönlich bin ganz zufällig zu Sarah Kane gekommen. Eine Frau, die ja ein wahnsinniges Leben – im wörtlichstes Sinne – geführt hat, die leider häufig missverstanden wurde. Das ist eine der Sachen, die ich an ihren Stücke so genial finde, weil sie auf einer oberflächlichen Seite vielleicht so aussehen, als ob sie einfach nur schocken wollen, als ob sie geschrieben wurden, damit das Publikum sich zum Schluss denkt: „Eh, kann man so was machen?“ Ich glaube nicht, dass das der Kern der Stücke ist, sondern ganz im Gegenteil: Das Interessante ist eigentlich, dass etwas auf einer Textebene zu sehen ist, das aber nicht den Kern bestimmt. Man sieht ganz häufig Gewalt, Exzesse, Vergewaltigungen, um die es im Kern aber eigentlich nicht geht, sondern um etwas tiefer Gehendes. Dass beispielsweise Gewalt eine starke Rolle spielt, aber es eigentlich um Liebe geht. In ihren Stücken geht es letztendlich immer auch um Liebe. Da ist „4:48“ eher noch eine Ausnahme, sag ich jetzt mal.
Andi: Sarah Kane ist natürlich in England hinein geboren in diese Generation von „In your face“. Und sie wird heute häufig immer noch missverstanden: Als „In your face“, was sie halt letztendlich nicht ist. Ihr Sachen hören sich hart an, aber da steckt mehr dahinter. Die Stücke sind Stücke, die es zu Lesen gibt und die komplett anders sind, wenn man sie auf die Bühne bringt. Es wird nicht selten einen riesigen Unterschied geben zwischen dem Stück, das man gelesen hat und dem Stück, das man sieht. Und das ist auch von ihr so gewollt: Dass man daran arbeitet und dass man die Regieanweisungen anders umsetzt, als sie da stehen. Dass man interpretiert und Lösungen findet. Sarah Kane ist DIE Autorin des Postmodernen Theaters.
Lydia: Solch einen Text kann man einfach niemals gleich auf die Bühne bringen. Das würden wahrscheinlich fünf Theater komplett anders inszenieren, weil es einfach, so wie es da steht, auch nicht inszenierbar ist. Und weil man eben wirklich immer für sich interpretieren muss, was da jetzt dahinter steckt. Genau das ist auch das Spannende bei „Gesäubert“: Diese permanente Gewalt, die aber eigentlich nur versucht, die Liebe zu beschreiben, oder die die Frage nach den Maßstäben stellt, in die man das überhaupt irgendwie zwängen kann.
Das Konzept des Experiments
Reflex: Und ihr habt euch für einen ganz bestimmten Aufbau des Abends entschieden. Wie kam das? Steht dahinter ein bestimmtes Konzept?
(die vier lachen laut)
Andi: Wollen wir diese Frage wirklich beantworten?
Maximilian: Nein.
Andi: Sollen wir sie die Schauspieler beantworten lassen?
Maximilian: Wollen wir schnell noch eine Antwort erfinden oder wollen wir die Wahrheit sagen?
Andi: Na gut: „4:48“ ist ja nur 20 Minuten lang. Und „4:48“ wird ein großes Experiment, ein großes Sich-Ausprobieren und wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen. Es ist noch nicht alles klar.
Lydia: „4:48“ ist als Prolog für „Gesäubert“angedacht gewesen. Die Sache ist, dass bei „4:48“ eben noch so viel in der Schwebe steht. Das war von Anfang an geplant.
Andi: Wir machen das Ding in zwei Wochen. Und die ganze Intensität der Proben spiegelt sich dann hoffentlich in der Intensität des Stückes wider. Das werden kurze und sehr, sehr aufreibende zwei Wochen Proben. Und ich hoffe, dass daraus auch aufreibende 20 Minuten entstehen. Wo wir aber sein werden, wenn diese zwei Wochen vorbei sind, das wissen wir noch nicht. Das wird sich zeigen. Letztendlich soll am Ende unserer Inszenierung auf jeden Fall der Moment stehen, an dem man überlegt: „Okay, 4:48, der Moment, an dem man innehalten und sich entscheiden muss: Wo steht man gerade in seinem Leben? Was macht man damit? Was mach ich mit meinem Wahnsinn, was mach ich mit meiner Depression? Wo bin ich? Will ich weitermachen, will ich nicht weitermachen?“ Und letztendlich kann man das natürlich gerne als Cliffhanger zu „Gesäubert“ sehen, wo man feststellt: „Wenn ich weiter machen will, dann brauche die Liebe dazu,“ und sich fragt: „Wo krieg ich die Liebe her?“ Dieser Übergang wär ein möglicher Gedanke. Aber letztendlich ist ein glatter Übergang jetzt nicht das, was angedacht ist.
Die Grundfragen sind solche, die sich jeder Mensch stellt
Lydia/Maximilian: Ich wollt dazu noch sagen:
Maximilian: Warum sprechen wir immer gleichzeitig?
Lydia: Weil wir gleichzeitig denken…?
Maximilian: Ich glaube, was die Stücke von Sarah Kane auch ganz viel ausmacht, weshalb es auch gut möglich ist, an einem Abend mehrere Stücke zu inszenieren, ist, dass die Grundfragen welche sind, die sich jeder Mensch selber stellt. Ganz sicher nicht – oder hoffentlich nicht — in dieser Intensität, wie Sarah Kane das tut. Aber Fragen wie: „Was mach ich mit meinem Leben? Was beschäftigt mich? Was macht mich aus? Wie kann ich weitermachen, wenn ich an einer Krisensituation vielleicht scheitere? Was ist Liebe, was macht Liebe aus? Wie kann ich das überprüfen? Liebe ich oder mach ich mir etwas vor?“ Das sind, denk ich, alles Fragen, die durchaus im Menschen brodeln, wenn sie auch gleich nicht immer so gestellt werden. Und das macht die Stücke auch durchaus auf einer rein menschlich emotionalen Ebene verknüpfbar.
Lydia: Es sind eben auch letztlich diese Identitätsfragen und ich würde sagen, dass „4:48“ genau an dieser Frage hängt: „Wer bin ich und wo geht das noch hin?“. Bei „Gesäubert“ stehen die Charaktere aber schon vor der nächsten Frage, denn sie wissen, wo sie hin wollen. Genau darüber haben sie vielleicht ein bisschen vergessen, wer sie sind. Für mich ist spannende, dass das Ziel da ist, aber darüber total vergessen wird, wer sie eigentlich sind oder man sich bei manchen Charakteren auch fragen kann: „Sind das noch Menschen?“ Diese ganzen Fragen der beiden Stücke greifen ineinander über.
Pausenloses Feedback, back-up und Ideen mal zwei
Re>flex: Wir haben es ja eben gemerkt: Es sind jeweils zwei Regisseure. Welche Probleme, welche Möglichkeiten eröffnen sich dadurch, wenn man zu zweit an einem Projekt arbeitet?
Maximilian: Man möchte immer gleichzeitig sprechen.
Lydia (lacht): Aber es gibt keine Probleme.
Maximilian: Nee, tatsächlich nicht. Das ist erstaunlich witzig.
Lydia: Ja, funktioniert wunderbar. Möglichkeiten gibt es natürlich viele. Zum Beispiel sie, noch mal andere Sichtweisen zu sehen und zu einer eigenen formulieren Aussage einen zweiten Blick zu bekommen.
Matthias: Wir haben ja schon in „Nach dem Frühlingserwachen“ zusammen gearbeitet, Andi und ich. Und der Hauptvorteil ist, dass man pausenloses Feedback hat, dass man nichts schon mal in seinem Kopf bereit legen kann, sondern alles wird direkt getestet. Viele Ideen fallen dann von vornherein schon mal durch. Man merkt in dem Moment, in dem man es ausspricht gleich: „Ok, das war jetzt nicht so helle.“ Aber dadurch hat man auch eine radikale erste Aussiebung, so eine Art erste Qualitätskontrolle. Natürlich sind die Ideen, die man hat, mal zwei. Man hat seine eigenen Ideen und seine eigene Vorstellung davon, wie es weitergehen soll und die des Anderen. Auf diese Weise hat man viel mehr Potential.
Maximilian: Man pusht sich auch irgendwie gegenseitig hoch. Lydia und ich hatten es ganz oft, dass eine Idee im Raum stand und diese einfach vom Anderen nochmal weiter gesponnen wurde und sich plötzlich ganz neue Dimensionen eröffneten, die man so, in seiner eigenen Idee vielleicht gar nicht gesehen hat. Das macht es extrem spannend — einen Prozess langwieriger, das ist ganz klar — , letztendlich sehr viel fruchtbarer als es für einen alleine wäre.
Lydia: Man muss eben keine Entscheidungen alleine treffen. Man kann sich gegenseitig motivieren und man hat immer so ein back-up. Wenn ich mir selber mit irgendwas nicht ganz sicher bin, gibt es jemand Zweiten hinter mir, der auch der Meinung ist und der das genauso mit vertreten kann.
Gruppendynamik statt „Mach mal so und mach mal anders.“
Reflex: Das hätte man ja auch mit einem Regieassistenten, oder nicht?
Lydia: Das ist nicht das Gleiche.
Andi: Ich sträube mich von Anfang an gegen den Begriff „Regieassistenz“.
Maximilian: Ich wollt’s gerade sagen. Entweder gibt es jemanden, der führt mit Regie. Das ist dann aber keine Regieassistenz, denn eine Mitregie muss auf gleicher Ebene mitarbeiten können, sonst gibt’s eine Hierarchie und einer boxt da durch, was er will. Und Regieassistenz…, ich weiß nicht, in meinem Sprachgebrauch hat das irgendwie was negativ Behaftetes. Die Regieassistenz ist halt der Hiwi, der die Drecksarbeit macht, der aufschreibt, was der andere vorn erzählt. Das passt auch irgendwie gar nicht zum Konzept, das wir und ihr (er deutet auf das andere Team) ja auch letztendlich fahren. Unser Konzept zielt nicht darauf, dass sich vorn ein Regisseur hinstellt, und sagt: Mach mal so und mach mal anders. Sondern das ist ja ein riesiger Gesamtprozess, in welchem nicht nur die Regie, sondern auch die Schauspieler wahnsinnig viel mit entscheiden dürfen und wollen. Was das Projekt natürlich auch zu einem macht, hinter dem alle stehen. Was die Arbeit auch sehr viel angenehmer macht, als wenn es einen gibt, der sich vorn hinstellt und elf, die dahinter stehen und sich denken: „Hm, ja, ok. Hat er mal wieder heute morgen, als er über die Schwelle kam, sich was ausgedacht.“
Lydia: Es geht insgesamt auch viel um Gruppendynamik und um ein Team und zwar zusammen mit den Schauspielern. Da ist es natürlich sehr hilfreich, wenn die Regisseure an sich schon ein Team darstellen.
Andi: Und deswegen sind wir auch – und da stimmt ihr mir sicher auch zu – auch eigentlich keine Regisseure (die drei stimmen ihm wild durcheinander zu). Das sagen wir nur immer noch so, weil es so einfach ist, „Regie“ zu sagen. Aber letztendlich wird im Programmheft nicht Regie drin stehen, weil wir nicht Regie führen. Sondern wir sind die Leiter eines Projektes und deswegen braucht es auch solche Abgrenzungen von Regie und Regieassistenz nicht. Jeder macht halt das, was er kann.
Intensität auf zwei Wegen
Reflex: Kommen wir noch einmal zurück: Ihr probt ja schon ganz lang, ihr anderen habt vor, das Ganze in zwei Wochen zu stemmen. Ihr seid ja jetzt schon da. Es hat also auch einen ganz bestimmten Grund, weshalb ihr erst zwei Wochen vor der Premiere erst anfangt.
Andi: Also, der ganz bestimmte Grund ist natürlich, dass dieses Stück ein sehr kleines und sehr eng gepacktes Stück werden soll. Und dieses Enge und Gedrängte soll sich im Probenprozess genauso widerspiegeln wie letztendlich auf der Bühne. Wenn ich ein Theaterstück mach, dann sind der Probenprozess und die Inszenierung gleich wichtig. Wenn mir meine Schauspieler danach an die Decke springen, weil das so Kacke war, dann bringt das beste Stück überhaupt nichts. Das heißt, beides muss Hand in Hand gehen. Und bei einem kurzen, engen, gedrängten Stück soll das Team dieselbe Erfahrung im Probenprozess haben. Und erst durch den eng gedrängten Probenprozess, wird es vielleicht möglich, diese Stimmung mit rüber in das Stück nehmen.
Re>flex: Und fühlt sich die andere Gruppe von „Gesäubert“ wohl mit der langen Probenphase?
Lydia: Auf jeden Fall. Weil wir erst mal ganz viel gruppendynamisch arbeiten wollten, mit Schauspielübungen, mit Bewegungen, ganz viel wirklich ausprobieren wollten. Wir haben auch ganz bewusst relativ spät erst mit der eigentlichen Stückarbeit begonnen. Es ist zum Teil sehr schön, dass wir jetzt eben schon dieses Team von 10 Leuten geworden sind, dadurch dass wir bereits ein dreiviertel Jahr ganz unter uns die gleiche Arbeit miteinander teilen.
Paula Linke
http://www.reflexmagazin.de/2013/06/27/sarah-kane-mal-zwei/