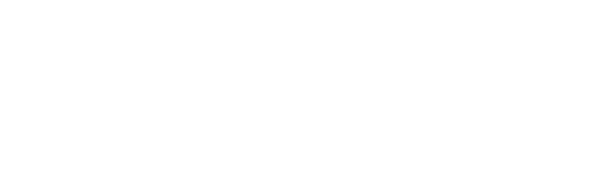Was zur Hölle ist ein Black Hole Converter?
 Gottes Wege sind unergründlich. Er haucht den Menschen Seelen ein, begeistert, inspiriert sie. Und er schenkt auf diesem Weg einem Doktor ohne Namen sogar einen ganzen Kosmos. Ein wenig göttlicher Odem hat denn wohl auch die Regisseurin Sybille Steinhauer gestreift. Sie inszenierte für die Studiobühne das Stück Der letzte der Timelords. Eine Adaption der britischen Science Fiction-Serie Doctor Who.
Gottes Wege sind unergründlich. Er haucht den Menschen Seelen ein, begeistert, inspiriert sie. Und er schenkt auf diesem Weg einem Doktor ohne Namen sogar einen ganzen Kosmos. Ein wenig göttlicher Odem hat denn wohl auch die Regisseurin Sybille Steinhauer gestreift. Sie inszenierte für die Studiobühne das Stück Der letzte der Timelords. Eine Adaption der britischen Science Fiction-Serie Doctor Who.
Ein christliches Laienspiel erzählt im Grunde nichts Neues. Sowohl die Mitspieler, als auch die Zuschauer kennen bereits die Geschichten. Es geht darum, sich des Mythos zu versichern, und der wird höchst präzise nachvollzogen. Theatrale Qualitäten, dramaturgische Erfordernisse stehen dabei zurück, hinter dem Ausdruck tief empfundener Devotion.
In unserer säkularen Zeit, die von Agnostik und Atheismus geprägt ist, haben wir unsere Götter und Mythen arbitrarisiert – zufällig geraten fiktive Gestalten zu Kultobjekten. Statt Ikonen malen Künstler heute Mickey Mouse, Superman oder Manga-Helden. Die Gestae der Päpste sind von den Bestsellerlisten gerutscht. Stattdessen werden Internetarchäologen dereinst riesige Fan Fiction-Bibliotheken heben. Inspiration beziehen die Schreiber und Maler dieser zeitgeschichtlichen Devotionalien nicht mehr von einer zentralen Gottheit, sondern von den verschiedenen Helden aus Film-, Buch– und Comic-Reihen. Und ihnen widmen sich auch hier und da Bühnenstücke, gewissermaßen Laienspiele ohne Religion.
Ein solches hat Sybille Steinhauer nun für die Studiobühne geschaffen. Kein weiches Brot: Bei der Premiere höre ich hinter mir schon die Dogmatiker raunen. Einige von ihnen tragen die rituelle Kleidung: Kostüme der geliebten Helden. Die Serie, um die es an diesem Abend geht, heißt Doctor Who und wird bereits seit mehr als einem halben Jahrhundert von der BBC produziert.
Doctor Who ist ein zeitreisender Alien, ein Timelord, der nahezu ewig lebt. Auch töten kann man nur schwer. Dabei sieht er einem Menschen zum Verwechseln ähnlich und hegt große Zuneigung zu uns Erdenbürgern. Seit Erfindung der Figur im Jahre 1963 hat sich ein gigantischer Kosmos entwickelt, der von der Genesis bis ans Ende der Zeit und vom Herz des Universums bis an dessen äußerste Ränder reicht. Kein Wunder also, dass man nicht alle Details der Serie auf Anhieb verstehen kann, wenn man mal eine Episode anknipst.
Wer sich Der letzte der Timelords im E-Werk ansieht, sollte sich auch ein wenig schlau gemacht haben, worum es geht. Es lohnt sich, die Kurzbeschreibung der adaptierten Episoden durchzulesen (mehr). Wem dann noch nicht alles klar ist, bleibt die Doctor Who Wiki – dort werden die TARDIS, der Master oder der Sonic Screwdriver erschöpfend erklärt.
Für den unbedarften Zuschauer bleibt Steinhauers Inszenierung durchaus ein wenig hermetisch. Auch, weil sie stark auf die Dramaturgie der Filme setzt, statt den Stoff zu theatralisieren. Einigen im Publikum stehen am Ende die Fragezeichen deutlich ins Gesicht geschrieben. Die Dogmatiker aber lächeln wohlwollend. Sie sind auf ihre Kosten gekommen. Wurden sogar mit ein paar zusätzlichen Anspielungen belohnt, die garantiert nur sie verstehen.
Zum krönenden Abschluss des Stücks können die Zuschauer dann noch selbst Teil des Mythos werden. Sybille Steinhauer lädt sie ein, sich auf der Bühne fotografieren zu lassen, direkt vor der originalgetreu nachgebauten Zeitmaschine TARDIS. Die ist ein echtes Meisterwerk von Marc Haller: Sie ist innen tatsächlich größer, als es von außen scheint.
Dennis Dreher
http://www.reflexmagazin.de/2012/04/12/was-zur-holle-ist-ein-black-hole-converter/